Wenn der „Baby Blues“ bleibt – Ein Überblick zur postpartalen Depression
Eine Schwangerschaft und die Geburt eines Babys werden vor allem mit Glück und Freude verbunden - ein vielleicht lang gehegter Kinderwunsch ist endlich in Erfüllung gegangen und die Familie ist um ein neues kleines Wesen gewachsen. Familie und Freund:innen freuen sich für die frischgebackene Mama und überhäufen sie mit Glückwünschen und Geschenken.Traurigkeit, Niedergeschlagenheit oder gar depressive Verstimmungen passen im ersten Moment so gar nicht zu diesem neu erlangten Mutterglück und sind nicht die Assoziationen, die man mit dieser Lebensphase in Verbindung setzt ... oder?
Doch Depressionen können in jeder Lebensphase auftreten – auch in jenen, die wir vortrefflich mit Glück und Freude verbinden. Postpartale Depression, auch unter dem Namen Wochenbettdepression bekannt, bezeichnet eine Depression, die innerhalb der ersten 6 Wochen nach der Entbindung auftritt. Im Gegensatz zum sogenannten Baby Blues, einem Stimmungstief wenige Tage nach der Geburt, das viele Neu-Mamas erleben, ist die postpartale Depression eine länger überdauernde und behandlungsbedürftige psychische Erkrankung.
Woran erkennt man eine postpartale Depression?
Die Symptome der postpartalen Depression unterscheiden sich nicht von einer „normalen“ Depression in anderen Lebensphasen. Depressionen sind gekennzeichnet durch Niedergeschlagenheit und Traurigkeit sowie durch Interessenverlust und Anhedonie, also Freudlosigkeit. Eine Person, die an einer Depression leidet, ist oftmals nahezu durchgehend niedergeschlagen und kann sich nicht mehr an Dingen erfreuen, die ihr oder ihm früher gute Laune bereitet haben, wie zum Beispiel ein Treffen mit den Liebsten oder das Kochen und Genießen des Lieblingsgerichtes. Darüber hinaus können weitere Symptome wie Antriebslosigkeit, Selbstzweifel, Ängste und körperliche Beschwerden wie Unruhe und Konzentrationsschwierigkeiten auftreten.
Einen wichtigen Unterschied zur Depression in anderen Lebensphasen gibt es jedoch: Die betroffenen Mütter empfinden starke Schuldgefühle gegenüber dem Baby.
Das liegt daran, dass es ihnen schwer fällt kindliche Signale wahrzunehmen, diese angemessen zu interpretieren und darauf einfühlsam zu reagieren. Frauen, die an einer Wochenbettdepression leiden, berichten über Schwierigkeiten, mütterliche Gefühle zu entwickeln bis hin zu einer Gefühllosigkeit gegenüber ihrem Baby. Das kann sich negativ auf den Aufbau der Mutter-Kind-Bindung und auf das Kind auswirken, was sich beispielsweise durch emotionale Auffälligkeiten und Verhaltensauffälligkeiten äußert. Auch Zwangsgedanken (z. B. das Kind zu verletzen) sind nicht selten. Zwangsgedanken sind Vorstellungen und Gedanken, die als unsinnig und übertrieben erkannt werden, also nicht die eigene Meinung oder Überzeugung wiedergeben, sich aber dennoch immer wieder im Inneren aufdrängen. Sie schockieren die Mutter, versetzen sie in Angst und erzeugen noch mehr Schuldgefühle. Dadurch können sich die depressiven Symptome weiter verstärken und ein Teufelskreis wird in Gang gesetzt.
Scham- und Schuldgefühle führen dazu, dass sich Betroffene nicht trauen, anderen gegenüber offen zu sein und über ihre Gefühle zu sprechen. Zu groß ist die Angst, nicht einem bestimmten Idealbild zu entsprechen und als „schlechte Mutter“ abgestempelt zu werden.
Niemand trägt die Schuld!
Das Wichtigste gleich vorweg: Keine Mama hat Schuld daran, wenn sie nach der Geburt ihres Kindes eine Wochenbettdepression entwickelt. Eine postpartale Depression ist eine psychische Erkrankung, die theoretisch jede Neu-Mama treffen kann, sowohl eine Frau, die vielleicht ungeplant schwanger wurde als auch eine Frau, die schon lange einen Kinderwunsch gehegt hat.
Für alle psychischen Erkrankungen gilt: Den einen Auslöser gibt es nicht. Es spielen immer verschiedene Faktoren eine Rolle - “multifaktoriell bedingt” ist der Ausdruck, den Psycholog:innen bei nahezu jeder psychischen Krankheit verwenden. Es gibt innere und äußere Faktoren, die dazu beitragen können. Zu den inneren Faktoren zählen beispielsweise ein geringes Selbstwertgefühl oder unzureichend verarbeitete traumatische Erlebnisse. Belastende Lebenserfahrungen wie Trennungen oder der Verlust des Arbeitsplatzes gehören zu den äußeren Faktoren. Auch eine genetische Vorbelastung kann die Anfälligkeit, eine psychische Erkrankung zu entwickeln, erhöhen. Welche Rolle diese verschiedenen Aspekte, beziehungsweise Risikofaktoren, bei der Entstehung einer Erkrankung spielen, ist individuell unterschiedlich.
Die Geburt als Wendepunkt im Leben
Die enormen Hormonveränderungen während Schwangerschaft, Geburt und Stillzeit scheinen einen Einfluss auf die Entstehung psychischer Erkrankungen zu haben. Nach der Entbindung wird beispielsweise der damit verbundene Östrogenabfall als ein möglicher Risikofaktor für die Entstehung einer Wochenbettdepression gesehen. Neben dem Hormonhaushalt der Frau wird durch die Geburt auch das ganze Leben der Eltern auf den Kopf gestellt. Ein Baby verändert die Dynamik der Partnerschaft und bringt gewohnte Routinen aus dem Gleichgewicht. Plötzlich ist da ein kleines Wesen, dass die ungeteilte Aufmerksamkeit der Eltern braucht und dessen Bedürfnisse erst kennen gelernt werden müssen. Die neue Rolle als Mutter und die damit verbundenen Aufgaben und Herausforderungen erfordern enorme Anpassungsleistungen. Das kann körperlich und seelisch sehr belastend sein und die Entwicklung einer postpartalen Depression begünstigen.
Behandlung einer postpartalen Depression
Die positive Nachricht - Wochenbettdepressionen sind gut behandelbar. Die Art der Behandlung richtet sich hierbei nach der Schwere der Erkrankung. Bei einer milden Symptomatik kann schon ein Austausch mit anderen Betroffenen, zum Beispiel im Rahmen einer Selbsthilfegruppe, helfen. Eine mittlere bis stark ausgeprägte Symptomatik erfordert oftmals eine psychotherapeutische Behandlung. Diese hilft der Mutter zum Beispiel dabei, Strategien zur Stressbewältigung zu lernen und unterstützende Ressourcen zu aktivieren. Außerdem sollte auch der Mutter-Kind-Beziehung Aufmerksamkeit geschenkt werden, um negative Auswirkungen auf das Baby zu verhindern und eine sichere Bindung zu unterstützen. Es empfiehlt sich, das soziale Umfeld, beispielsweise Familie, Freundinnen und Freunde mit einzubeziehen, um die Mutter zu entlasten. Bei jeder Form der Behandlung spielt die Aufklärung über das Krankheitsbild eine zentrale Rolle. Es ist wichtig, dass sowohl die Betroffene, als auch das Umfeld verstehen, dass es sich bei der postpartalen Depression um eine psychische Erkrankung und kein persönliches Versagen der Mutter handelt. Dies schafft Verständnis und sorgt für eine Entlastung der Schuldgefühle auf Seiten der Mama.
Nach Hilfe und Unterstützung zu frage,n kann für betroffene Mütter, die sich für ihre Gefühle schuldig fühlen und Angst haben, deshalb von anderen verurteilt zu werden, sehr schwer sein. Doch oft gibt es tatsächlich viele Menschen im persönlichen Umfeld oder auch professionelle Ansprechpartner:innen, die nicht Urteilen, sondern Unterstützung bieten, diese schwierige Situation zu meistern - denn keine Mama sollte eine postpartale Depression allein bewältigen müssen!
Hilfe: Wohin können sich Betroffene oder Angehörige wenden
Wenn du das Gefühl hast, dass du selbst oder dein:e Partner:in an einer postpartalen Depression leidet, konsultiere eine ärztliche oder professionelle Stelle (z. B. Gynäkolog:in, Hebamme) bzw. bestärke sie darin, sich professionelle Unterstützung zu suchen.
Unter diesen Links findest du zusätzliche Informationen und Hilfe:
- Selbsthilfeorganisation zu peripartalen psychischen Erkrankungen
- Stiftung Deutsche Depressionshilfe: Infos und Hilfe bei Depression
Gastautorin: Susanne Hembd-Peuse, Psychologin
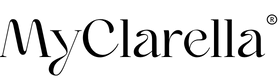




Hinterlasse einen Kommentar
Alle Kommentare werden vor der Veröffentlichung geprüft.
Diese Website ist durch hCaptcha geschützt und es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen und Datenschutzbestimmungen von hCaptcha.